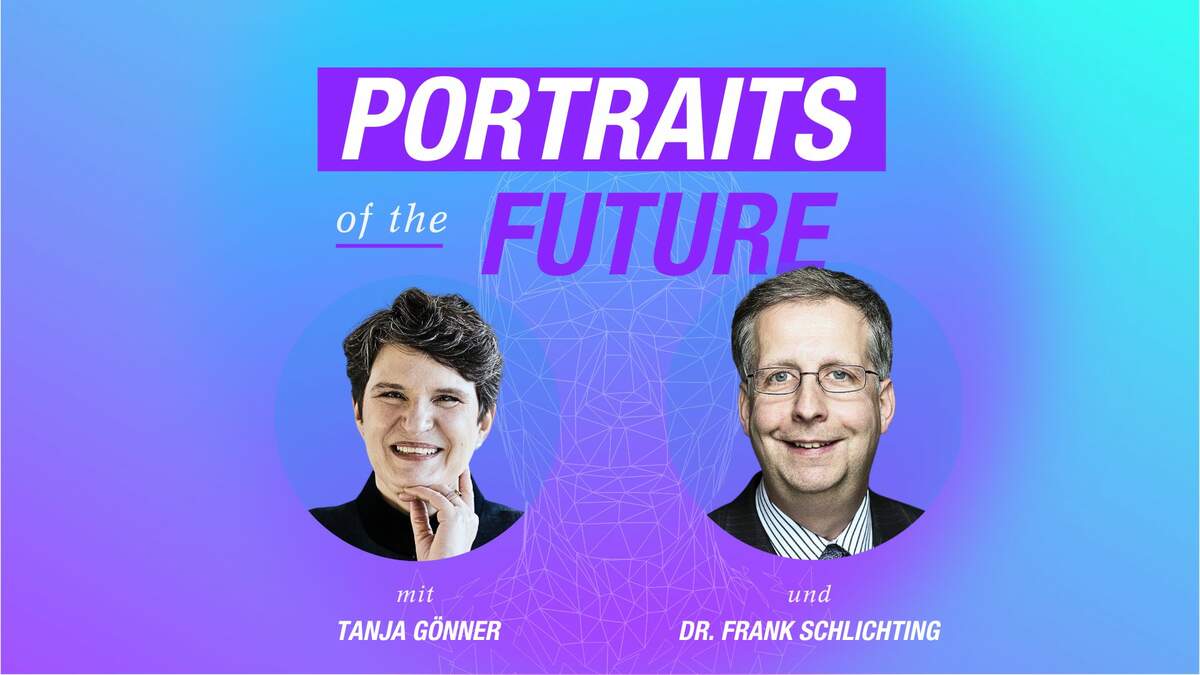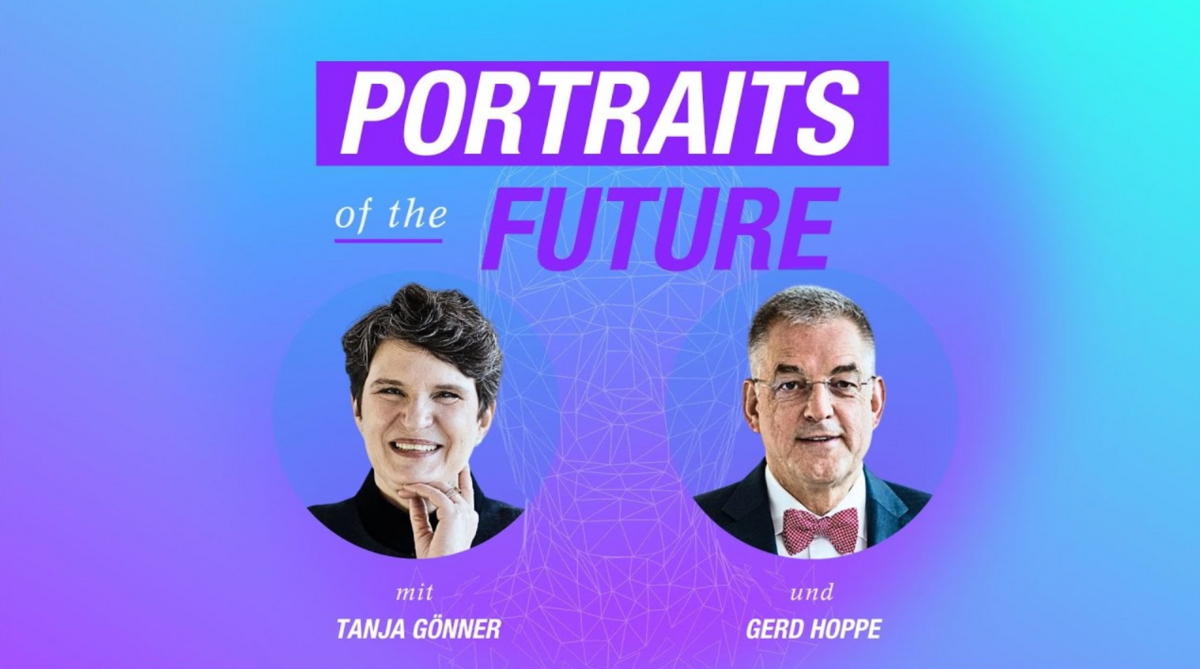© BDI
Portraits of the Future: Wie deutsche Innovationen heute schon das Morgen prägen
Innovationen sind mehr als technischer Fortschritt: Sie bedeuten, Verantwortung zu übernehmen, Veränderungen aktiv zu gestalten und neue Wege zu gehen. "Portraits of the Future" zeigt, wie Unternehmen in Deutschland mit klugen Ideen und neuen Technologien vorangehen und damit unsere Industrie zukunftsfest machen. BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner im Gespräch mit SaxonQ, Wöhner, Sightwise, Phoenix Contact, Festo und Beckhoff.
Deutschland hat eine der innovativsten Industrien – und sprudelt vor neuen Ideen. Ein Beispiel dafür ist SaxonQ GmbH: Gemeinsam mit seinem Team hat Dr. Frank Schlichting einen mobilen Quantencomputer entwickelt, der ohne aufwändige Infrastruktur auskommt. Einfach an die Steckdose anschließen, und er läuft. Damit erschließt das Startup neue Einsatzmöglichkeiten – etwa beim autonomen Fahren. Weitere Anwendungen, zum Beispiel in der Logistik oder der Medizinforschung, sollen folgen und neue Maßstäbe setzen.
Wie lassen sich elektrische Anlagen in Fabriken oder Gebäuden einfacher, schneller und sicherer installieren? Das familiengeführte Unternehmen Wöhner GmbH & Co. KG - Elektrotechnische Systeme hat dafür eine smarte Lösung entwickelt: ein modulares System zur Energieverteilung, das sich wie ein Baukasten montieren lässt - ohne großen Aufwand. Das spart Zeit, schont Ressourcen und wirkt dem Fachkräftemangel entgegen. In meinem Gespräch mit CEO Philipp Steinberger zeigt sich, wie eng Praxiswissen und Innovation zusammengehen. Viele Entwicklungen entstehen im direkten Austausch mit den Kunden – anwendungsnah und passgenau. Damit solche Lösungen auch künftig möglich sind, braucht es aber auch politische Rahmenbedingungen, die verlässliche Perspektiven schaffen und die Innovationskraft des Mittelstands gezielt stärken.
Bei Sightwise GmbH wurde mit Co-Founder Nils Gutsche über diese Frage gesprochen. Das Startup hat eine Technologie entwickelt, die Oberflächen automatisch prüft – präzise, zuverlässig und unabhängig vom Material. Besonders spannend ist, wie die KI mit synthetisch generierten Trainingsdaten schnell dazu lernt und so auch neue Schadensbilder sicher erkennt. Die Gründungsmitglieder entwickelten die Idee aus ihrer Forschung an der Leibniz Universität Hannover. Im Gespräch wird deutlich, wie sie aus einem wissenschaftlichen Ansatz in enger Zusammenarbeit mit der Industrie ein marktfähiges Produkt gemacht haben. Dabei hatten sie stets das Ziel vor Augen, die Qualitätssicherung effizienter zu machen. So entstand eine Lösung, die sich in der Praxis nun verlässlich bewährt. Damit das Startup nun wachsen und erfolgreich skalieren kann, braucht es im nächsten Schritt weiteres Kapital. Genauso wichtig ist es, Vertrauen in die Technologie aufzubauen, denn nur wenn Unternehmen offen für den Einsatz von KI sind, lässt sich das volle Potenzial ausschöpfen. Auch die Rahmenbedingungen am Standort müssen besser werden. Noch ist einiges zu tun, damit Innovationen hier nicht nur entstehen, sondern auch langfristig bleiben.
Gleichstrom ist kein neues Konzept, doch bei Phoenix Contact bringen Wilhelm Scholle und seine Kolleginnen und Kollegen diese Technologie jetzt gezielt in die Fabrik. Dabei profitiert DirectCurrent von der Möglichkeit, Energie, die bei Bewegungen von Robotern oder Fahrstühlen entsteht, zurück in das Energienetz einzuspeisen. Dadurch entsteht ein intelligentes System, das Energie genau dort verfügbar macht, wo sie benötigt wird. Gleichzeitig bietet das Prinzip im industriellen Einsatz weitere Vorteile: Es senkt den Energieverbrauch, erhöht die Resilienz, entlastet das Netz und spart dabei Ressourcen wie beispielsweise Kupfer. Damit Gleichstrom aber sein volles Potenzial entfalten kann, braucht es mehr als gute Ideen aus der Industrie. Auch die Politik ist gefragt: mit Rahmenbedingungen, die Kreativität fördern und Forschung und Industrie besser vernetzen. Nur so lässt sich der Weg frei machen für nachhaltige Entwicklungen, die Ressourcen schonen und unsere Industrie langfristig stärken.
Beim Besuch zeigt Dr. Ansgar Kriwet, wie das Familienunternehmen mit Bionik neue Impulse setzt und Automatisierung effizienter und nachhaltiger gestaltet. Der Mittelständler lernt dabei von der Natur, die Hunderte von Millionen Jahre Erfahrung mitbringt und Vorbilder für Lösungen in der mechanischen Konstruktion oder für mehr Energieeffizienz liefert. Damit Deutschland ein Innovationsstandort bleibt, braucht es mehr Vertrauen und Freiraum. Politik und Unternehmen müssen diese Voraussetzungen gemeinsam schaffen, indem sie Bürokratie abbauen und bestehende Abläufe kritisch hinterfragen. Gemeinsam wurde schon unglaublich viel erreicht und es gibt keinen Grund, mutlos zu sein.
Was passiert, wenn man klassische Steuerungstechnik neu denkt? Beim Mittelständler Beckhoff Automation entstehen dadurch effiziente Systeme, die Produktionsprozesse spürbar verbessern. Statt auf spezialisierte Hardware zu setzen, wird die Steuerung per Software simuliert. Das macht die Produktion schneller und präziser. Im Gespräch mit Gerd Hoppe, Corporate Management, wurde ein eigens entwickelter Compiler demonstriert, der mehr Code in kürzerer Zeit verarbeitet. Der Vorteil: Unternehmen können ihre Anlagen dadurch besser auslasten oder sogar kleiner dimensionieren und so Geld sparen. Für solche Fortschritte braucht es aber nicht nur Technik, sondern auch politische Unterstützung. Wenn der Mittelstand weiterhin eigenständig Innovationen entwickeln soll, müssen Forschungsaufwendungen steuerlich einfacher abzuschreiben sein und das möglichst unbürokratisch.