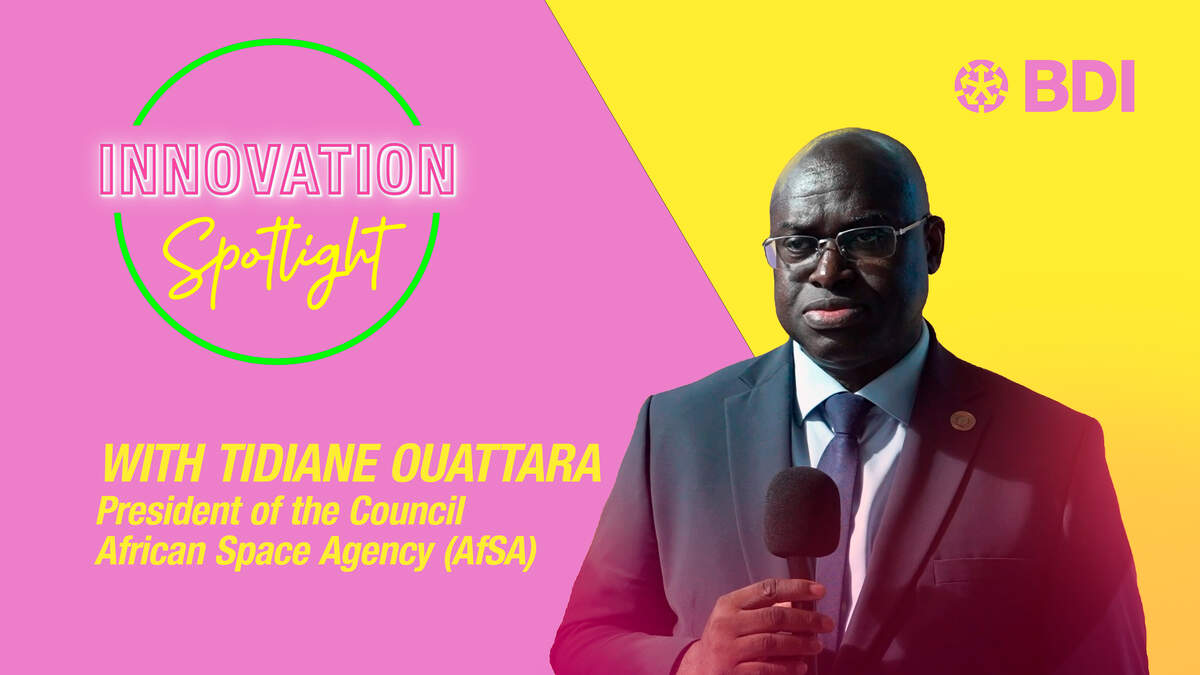Innovation stärken. Zukunft sichern.
Mit strategischer Innovationspolitik zu neuer Wettbewerbskraft.
Deutschland kann Innovation. Sie ist unsere DNA. Über Jahrzehnte hinweg stand „Made in Germany“ für Produkte, die nicht nur funktionierten, sondern auch begeisterten. Heute droht diese Begeisterung zu verblassen – durch überbordende Bürokratie, hohe Standortkosten und eine zu geringe Innovationsoffenheit. Laut einer aktuellen Allensbach-Umfrage sagen 54 Prozent der Unternehmen, dass die Politik derzeit wenig oder nichts zur Innovationsförderung beiträgt. Fast jedes zweite große Industrieunternehmen hat Forschungsbereiche bereits ins Ausland verlagert – oder denkt darüber nach.
Wer Innovation fördern will, muss handeln – entschlossen, pragmatisch und zukunftsgerichtet. In einer globalisierten Welt, in der technologische Entwicklungen rasant voranschreiten, ist Innovation der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes. Denn die Herausforderungen sind gravierend: Der demografische Wandel führt zu einem alarmierenden Fachkräftemangel, der ohne innovative Ansätze in der Ausbildung und im Arbeitsumfeld nicht bewältigt werden kann. Der Klimawandel ist eine drängende Krise, die innovative Technologien im Bereich erneuerbarer Energien und nachhaltiger Produktion unabdingbar macht.
Wir leben in einer Zeit, in der internationale Abhängigkeiten zur Bedrohung werden können. Deutschland muss über Produkte und Lösungen verfügen, die andere dringend brauchen und die nur hier entstehen können. Die Leidenschaft für Exzellenz sowie die Fähigkeit, Technologie auf einzigartige Weise nutzbar zu machen, ist unser größter Wettbewerbsvorteil – und der Schlüssel zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit.
Deutschland hat ein starkes Innovationssystem und hohe private Forschungsausgaben. Jetzt braucht es auch eine Politik, die Innovation ermöglicht – nicht verwaltet. Die Start-ups fördert und die digitale Infrastruktur stärkt. Die große Unternehmen, den Mittelstand und die Politik zu Partnern macht. Die Schlüsseltechnologien schneller umsetzt und bürokratische Hürden abbaut. Wir brauchen eine Innovationsstrategie, die nicht nur reagiert, sondern die Zukunft aktiv gestaltet. Vier von fünf Unternehmen sind überzeugt: Die Politik kann einen Unterschied machen.
Exzellenz durch Leidenschaft. Innovation aus Überzeugung. Nur so können wir nachhaltiges Wachstum fördern und die Zukunft Deutschlands sichern. Handeln wir jetzt – wir können es doch!
So entfesseln wir Innovationen für Deutschland
Ein erfolgreicher Wissenstransfer stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Entscheidend sind langfristige Partnerschaften zwischen Forschung und Wirtschaft sowie professionelle, mittelstandsnahe Transferstrukturen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Programme wie die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) und das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) müssen gestärkt, SPRIND (Bundesagentur für Sprunginnovationen) und DATI (Deutsche Agentur für Transfer und Innovation) strategisch verzahnt werden. Forschungstransfer gehört ins Zentrum der Standortpolitik – inklusive des 3,5-Prozent-Ziels für Investitionen in Forschung und Entwicklung. Normung und Standardisierung sollten dabei als industriepolitische Hebel systematisch eine Rolle spielen.
Um Innovationen wirksam voranzutreiben, braucht Deutschland exzellente Forschung statt Mittelmaß. Dafür müssen gezielt Spitzeninstitutionen gefördert und aus der Masse hervorgehoben werden – statt am Gleichheitsgrundsatz in der deutschen Wissenschaftslandschaft festzuhalten. Die aktuelle Zukunftsstrategie Forschung und Innovation verfolgt mit ihren sechs Missionen und 30 Teilmissionen zwar gesellschaftlich relevante Ziele, ist jedoch zu kleinteilig. Zudem fehlt eine klare Struktur: Ihre Missionen benötigen konkrete Projektpläne, klare Zuständigkeiten und messbare Ziele – in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Nur so lassen sich Zukunftsaufgaben strategisch bewältigen.
Das europäische Mikroelektronik-Ökosystem ist geprägt durch fragile Lieferketten, hohe Anfangsinvestitionen, fortlaufende Innovationskosten und lange Entwicklungszyklen. Damit Europa angesichts handelspolitischer Spannungen und des internationalen Subventionswettlaufs nicht den Anschluss verliert, braucht es eine vorausschauende Förderung entlang der gesamten Mikroelektronik-Wertschöpfungskette. Nur so sichern wir Versorgung, stärken High-End-Produkte und machen Europa global unverzichtbar. Die Bundesregierung sollte zudem auf ausgewogene Exportkontrollen drängen, die Sicherheit und wirtschaftliche Interessen in Einklang bringen.
Unternehmen brauchen Planungssicherheit und kostengünstigen sowie sicheren Zugang zu Molekülen, insbesondere Wasserstoff und Wasserstoff-Derivaten sowie CO2-neutralen Biokraftstoffen. Dafür müssen Rechtsrahmen national und europäisch harmonisiert, Definitionen praxistauglich gestaltet und in der Übergangsphase auch kohlenstoffarmer Wasserstoff zugelassen werden. Der Infrastrukturaufbau, Investitionen und steuerliche Rahmenbedingungen müssen beschleunigt, Raffinerien eingebunden und grüne Leitmärkte gefördert werden. Internationale Partnerschaften, der Abbau von Handelshemmnissen und Instrumente wie H2Global sind zu stärken. Wettbewerbsfähigkeit braucht Carbon-Leakage-Schutz – auch im Luft- und Seeverkehr.
Kohlenstoffmanagement ist ein zentraler Bestandteil einer wirksamen Klimastrategie – und ein entscheidender Innovationstreiber für die Industrie. Es umfasst neben Carbon Capture and Storage (CCS) und Carbon Capture and Utilization (CCU) auch die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre (Carbon Dioxide Removal, CDR). Für den Hochlauf dieser Technologien müssen nationale und europäische Rahmenbedingungen weiterentwickelt und zentrale Fragen zu Permanenz, Haftung, Messung und Bilanzierung von Negativemissionen geklärt werden. Aufgrund hoher Kosten braucht es kurzfristige Förderinstrumente und eine langfristige Marktperspektive. Der zügige Ausbau und das De-Risking einer CO2-Transport- und Speicherinfrastruktur sind dafür entscheidend.
Die Umsetzung von AI Act und Data Act muss so gestaltet werden, dass sie die Innovationskraft der deutschen Industrie stärkt. Rechtsunsicherheiten – insbesondere im Zusammenspiel mit der EU-DSGVO – dürfen nicht zu Investitionshemmnissen werden. Deshalb braucht es eine bürokratiearme, praxisnahe Durchführung mit klarer Kompetenzverteilung und ausreichend ausgestatteten Behörden. Die Bundesnetzagentur sollte als zentrale Anlaufstelle fungieren, flankiert von einem moderaten Sanktionsrahmen im Data Act. Für den AI Act ist eine schlagkräftige Behörde erforderlich, die die Interessen der Industrie auch auf europäischer und internationaler Ebene aktiv vertritt – als Voraussetzung für innovationsfreundliche Rahmenbedingungen.